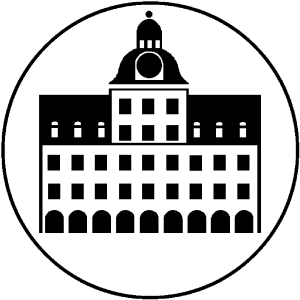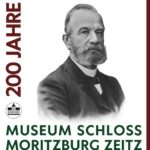In himmlischem Glanze
Zwei spätgotische Leuchterengel
Daten zum Glanzstück des Monats Juli
Zwei zusammengehörige spätgotische Leuchterengel
Kulturelle Einordnung: spätgotisch
Zeitstellung: um 1500
Material/ Technik: farbig gefasste Holzskulpturen
Maße VI/C-85 a: Höhe: 44,5 cm, Breite: 22 cm, Tiefe: 20 cm
Maße VI/C-85 b: Höhe: 45,5 cm, Breite: 21 cm, Tiefe: 19 cm
Inv. Nr.: VI/C-85 a und VI/C-85 b
Über das Glanzstück
In einer Zeit, in der der Glaube das tägliche Leben prägte, entstanden zahlreiche Kunstwerke mit liturgischer Funktion. Dazu zählen die beiden hier vorgestellten spätgotischen Leuchterengel. Statt zur bloßen Zier, fungierten sie als geschnitzte Akolythen (Altardiener), die einst mit ihrem Licht die Sakramentsmonstranz auf dem Altar flankierten.
Die beiden Skulpturen zeigen kniende Engel in jugendlicher Erscheinung, jeweils mit einem Kerzenleuchter in den Händen. Sie sind aus Laubholz geschnitzt und vollrund ausgearbeitet, was auf ihre ursprüngliche Funktion als freistehende Objekte, wie beispielsweise auf einem Altar, hindeutet. Beide Engel befinden sich in spiegelbildlicher Haltung, wobei jeweils das äußere Bein aufgestellt ist und das innere kniet – eine stabile und ausbalancierte Haltung, die auf das Zentrum zwischen ihnen ausgerichtet war.
Die Figuren messen 44,5 cm (VI/C-85 a) und 45,5 cm (VI/C-85 b) in der Höhe. Breite und Tiefe betragen jeweils rund 21-22 cm bzw. 19-20 cm. Beide Engel tragen eine schlichte liturgische Gewandung, bestehend aus einer Albe und einem Amikt mit kragenförmigem Zierbesatz (liturgisches Halstuch). Die Gesichter sind mit ausdrucksstarken Gesichtszügen und groben, kerbschnittartigen Locken versehen. Die ursprünglichen Flügel fehlen heute, sind jedoch anhand von rückseitigen Zapfenlöchern noch erkennbar.
Der ursprüngliche Zustand der Leuchterengel.
Foto: Mirko Negwer
Bei näherer Betrachtung zeigen sich feine Unterschiede in der Ausführung: Der rechte Engel wirkt mit geschlossenen Lippen und reduziertem Faltenwurf still und in sich gekehrt, während der linke durch einen leicht geöffneten Mund und längere, kalligrafisch gearbeitete Falten lebendiger erscheint. Auch im Bereich der Haare und Gesichtsoberflächen lässt sich eine unterschiedliche Handschrift erkennen. Dies deutet auf zwei verschiedene Schnitzer hin, die die beiden Engel als zusammengehörige Pendants geschaffen haben.
Beide Figuren wurden jeweils aus einem einzigen Laubholzblock geschnitzt. Der Werkblock wurde für die Bearbeitung waagerecht in eine Schnitzbank eingespannt – am Kopfende durch einen kräftigen Dorn bzw. Zapfen, am gegenüberliegenden Ende durch eine Befestigungsgabel. Letztere hinterließ häufig Zinkeneindrucke auf der Unterseite, wie sie bei vielen spätgotischen Holzskulpturen zu beobachten sind. Im weiteren Verlauf des Arbeitsprozesses wurde das Einspannloch anschließend wieder mit einem Holzzapfen verschlossen. Zudem zeigen die Standflächen deutliche Spuren späterer Eingriffe sowie Anobienzerstörungen (Holzwurmbefall). Weiterhin wurde der linke Leuchter samt Unterarm vermutlich im Zuge einer vorherigen Restaurierung ergänzt. Stilistische Abweichungen und Leimfugen mit Verdübelungen deuten auf diese spätere Maßnahme hin. Trotz kleiner Unterschiede fügt sich die Ergänzung weitgehend harmonisch ins Gesamtbild ein.
Der Zwischenzustand bei der Restaurierung. Die Engel wurden seitenverkehrt platziert.
Foto: Mirko Negwer
Die Leuchterengel waren ursprünglich farbig gefasst und partiell vergoldet. Erhaltene Reste am rechten Knie des rechten Engels lassen auf eine weiße Grundierung (Kreidegrund) und eine Polimentvergoldung schließen (Blattgold auf rotbraunem Poliment). Wahrscheinlich waren Augen, Lippen und Haare auch farblich differenziert ausgearbeitet. Spätere Überfassungen mit Goldbronze wurden im Laufe der Zeit entfernt. Heute präsentieren sich die Engel in holzsichtigem Zustand, überzogen mit einem dunkelbraunen Glanzüberzug aus einer jüngeren Restaurierungsphase. Die letzte Konservierung und Restaurierung wurde 2010/2011 von Mirko Negwer, Dipl.-Restaurator in Zeitz, durchgeführt. Dabei wurden sowohl konservatorische Maßnahmen zur Substanzerhaltung als auch restauratorische Eingriffe zur Stabilisierung und Ergänzung vorgenommen.
Die spätgotischen Leuchterengel sind ein wertvolles Zeugnis spätmittelalterlicher Kirchenausstattung um 1500. Sie vereinen formale Strenge mit feiner Individualität und zeugen von der engen Verbindung zwischen Kunst und religiösem Brauch im Mittelalter. Vergleichbare Beispiele aus der Zeit um 1500 – etwa aus der Werkstatt Tilman Riemenschneiders – finden sich in Eisenach im Besitz der Wartburg- Stiftung, im Mainfränkischen Museum Würzburg und im The Victoria and Albert Museum in London. Die Figuren beeindrucken nicht nur durch ihre handwerkliche Qualität, sondern auch durch ihre symbolische Aussage. Sie zeigen, dass solche Engelsfiguren nicht nur fester Bestandteil der mittelalterlichen Kirchenausstattung waren, sondern auch Ausdruck einer kunstvoll gestalteten Frömmigkeit. Trotz Verlusten, insbesondere der ursprünglichen Fassung und der Flügel, haben die Leuchterengel ihre ästhetische und inhaltliche Aussagekraft über die Jahrhunderte bewahrt. Heute sind sie Teil der Dauerausstellung zur Zeitzer Stadtgeschichte „Himmlisches Streben – Irdisches Leben“.
Text: Nadine Neumann
© Fotos wenn nicht anders genannt: MSMZ
Literatur:
Negwer, Mirko: Dokumentation zur Konservierung und Restaurierung: Zwei spätgotische Leuchterengel, 2010/ 2011, Zeitz.